Phase II - Der Projektaufbau
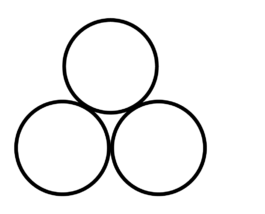
Die Doppelrolle und Selbstschutz
Marion Zurbach, Tänzerin & Choreografin in Marseille und Bern begann nach mehrjährigem Engagement bei Konzert Theater Bern in der freien Szene zu arbeiten, 2015 gründete sie die Unplush Dance Company, für die sie 2019 mit dem schweizerischen Nachwuchs-Tanzpreis (June Johnson Dance Price) ausgezeichnet wurde. An der Berner Hochschule der Künste (HKB) schloss sie den Master Expanded Theatre ab. Mit ihr haben wir über drei Projekte gesprochen: «Les Promises», ein Theaterprojekt über Lebensgeschichten junger Teenager Mädchen aus der Marseiller Banlieue, das wegen der Pandemie zu einem kollektiv realisierten Film wurde, «Biche», eine Performance über einen wegweisenden Unfall im Leben einer Tänzerin und «Body Lecture», einer Performance über Marions eigene Verletzungen als Balletttänzerin.
Ironischerweise war ich beim Projekt «Body Lecture» (2019), das meine Verletzungen als junge Balletttänzerin und die Transformation meines Körpers durch klassischen Tanz thematisiert, so gar nicht vor- und umsichtig. Ich habe bis zur Aufführung nicht realisiert, was es für mich bedeutet, über meine Verletzungen zu sprechen. Die erste Aufführung war ein ziemliches Experiment, ich wurde sehr kurzfristig angefragt, eine ausgefallene Performance zu ersetzen und selbst auf der Bühne zu sein. Ich konnte wenig Recherche machen, kündete ein Showing an. Nach der Premiere ging ich ins Bett und konnte nicht schlafen mit dem Gefühl, es nicht ein zweites Mal aufführen zu können. Erst da, mit 33 Jahren realisierte ich, wie ich das Thema mein ganzes Leben ausgeblendet hatte, es aber wichtig war, darüber zu sprechen. In diesem Moment wurde der Begriff der Selbstsorge/Care für mich zu einer entscheidenden Herausforderung. Ich hatte mit diesem Schock nicht gerechnet. Ich überlegte, was ich brauchte, um ein zweites Mal zu performen, ohne mich zu verletzen. Danach habe ich das Stück weiterentwickelt. Was mir dabei geholfen hat: ich war nicht alleine auf der Bühne. Meine Freundin und Osteopathin Camelia behandelt oder «pflegt» mich live auf der Bühne, zwischen uns ist viel Vertrauen und Zuneigung. Es ist sehr wichtig, welche Beziehung man zu seinen Bühnenpartner*innen aufbaut. Die Geschichte wird auch auf der Grundlage dieser Beziehung erzählt.
Zum Vergleich: bei «Biche» war es ähnlich: Ohne Géraldine Chollet als Freundin, Projektpartnerin und Tänzerin auf der Bühne, hätte ich die Geschichte nicht inszenieren können. Thematisiert man die eigene Geschichte, muss man zudem bedenken, was als Reaktionen nach dem Stück auf einen zukommen kann und wie man das auffängt.
Ein weiteres Tool zum Selbstschutz ist für mich die Gestaltung des Publikumsraum. Damit kann die Regie viel beeinflussen und die Erfahrung sensibler gestalten: ich habe nach der Premiere im Theatersaal bewusst ein kleineres Setting gewählt, in dem wenige Leute nah am Behandlungstisch sitzen. Das fand ich passender zum Intimitätsgrad der Geschichte, es ergab sich eine Art privater, wertschätzender Rahmen. Schliesslich ist mir auch am Publikum gelegen: ich will sie nicht überfordern mit einer krassen Geschichte, damit sie sich schlecht fühlen. Ich will etwas Konstruktives mit meiner Kunst auslösen.
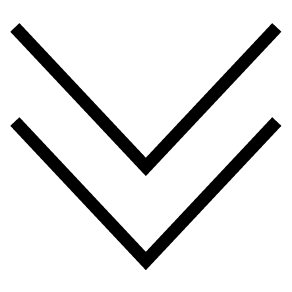
Reflektiere dein Projekt
Warum willst du dich selbst darstellen / aus deiner Perspektive sprechen? Und fühlst du dich bereit, über das dir Passierte zu sprechen und es zu inszenieren?
Wie recherchierst du für bzw. «in» deiner eigenen Geschichte – hast du dein Vorgehen in Bezug auf Selbstschutz und Struktur mit jemandem gespiegelt?
Wo liegt für dich bei der Reinszenierung d(einer) Geschichte die rote Linie?
Was brauchst und erwartest du von deinen Bühnenkolleg*innen, wenn du deine Geschichte performst? Habt ihr Exit- und/oder Care-Strategien gemeinsam entwickelt?
Wie willst du den Bühnenraum gestalten und somit die Nähe bzw. Distanz zum Publikum?
Phase II - Der Projektaufbau
Wer schreibt & spricht?
Marion Zurbach, Tänzerin & Choreografin in Marseille und Bern begann nach mehrjährigem Engagement bei Konzert Theater Bern in der freien Szene zu arbeiten, 2015 gründete sie die Unplush Dance Company, für die sie 2019 mit dem schweizerischen Nachwuchs-Tanzpreis (June Johnson Dance Price) ausgezeichnet wurde. An der Berner Hochschule der Künste (HKB) schloss sie den Master Expanded Theatre ab. Mit ihr haben wir über drei Projekte gesprochen: «Les Promises», ein Theaterprojekt über Lebensgeschichten junger Teenager Mädchen aus der Marseiller Banlieue, das wegen der Pandemie zu einem kollektiv realisierten Film wurde, «Biche», eine Performance über einen wegweisenden Unfall im Leben einer Tänzerin und «Body Lecture», einer Performance über Marions eigene Verletzungen als Balletttänzerin.
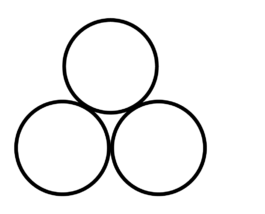
Ironischerweise war ich beim Projekt «Body Lecture» (2019), das meine Verletzungen als junge Balletttänzerin und die Transformation meines Körpers durch klassischen Tanz thematisiert, so gar nicht vor- und umsichtig. Ich habe bis zur Aufführung nicht realisiert, was es für mich bedeutet, über meine Verletzungen zu sprechen. Die erste Aufführung war ein ziemliches Experiment, ich wurde sehr kurzfristig angefragt, eine ausgefallene Performance zu ersetzen und selbst auf der Bühne zu sein. Ich konnte wenig Recherche machen, kündete ein Showing an. Nach der Premiere ging ich ins Bett und konnte nicht schlafen mit dem Gefühl, es nicht ein zweites Mal aufführen zu können. Erst da, mit 33 Jahren realisierte ich, wie ich das Thema mein ganzes Leben ausgeblendet hatte, es aber wichtig war, darüber zu sprechen. In diesem Moment wurde der Begriff der Selbstsorge/Care für mich zu einer entscheidenden Herausforderung. Ich hatte mit diesem Schock nicht gerechnet. Ich überlegte, was ich brauchte, um ein zweites Mal zu performen, ohne mich zu verletzen. Danach habe ich das Stück weiterentwickelt. Was mir dabei geholfen hat: ich war nicht alleine auf der Bühne. Meine Freundin und Osteopathin Camelia behandelt oder «pflegt» mich live auf der Bühne, zwischen uns ist viel Vertrauen und Zuneigung. Es ist sehr wichtig, welche Beziehung man zu seinen Bühnenpartner*innen aufbaut. Die Geschichte wird auch auf der Grundlage dieser Beziehung erzählt.
Zum Vergleich: bei «Biche» war es ähnlich: Ohne Géraldine Chollet als Freundin, Projektpartnerin und Tänzerin auf der Bühne, hätte ich die Geschichte nicht inszenieren können. Thematisiert man die eigene Geschichte, muss man zudem bedenken, was als Reaktionen nach dem Stück auf einen zukommen kann und wie man das auffängt.
Ein weiteres Tool zum Selbstschutz ist für mich die Gestaltung des Publikumsraum. Damit kann die Regie viel beeinflussen und die Erfahrung sensibler gestalten: ich habe nach der Premiere im Theatersaal bewusst ein kleineres Setting gewählt, in dem wenige Leute nah am Behandlungstisch sitzen. Das fand ich passender zum Intimitätsgrad der Geschichte, es ergab sich eine Art privater, wertschätzender Rahmen. Schliesslich ist mir auch am Publikum gelegen: ich will sie nicht überfordern mit einer krassen Geschichte, damit sie sich schlecht fühlen. Ich will etwas Konstruktives mit meiner Kunst auslösen.
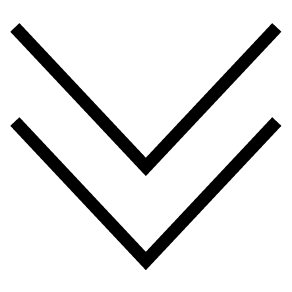
Reflektiere dein Projekt
Warum willst du dich selbst darstellen / aus deiner Perspektive sprechen? Und fühlst du dich bereit, über das dir Passierte zu sprechen und es zu inszenieren?
Wie recherchierst du für bzw. «in» deiner eigenen Geschichte – hast du dein Vorgehen in Bezug auf Selbstschutz und Struktur mit jemandem gespiegelt?
Wo liegt für dich bei der Reinszenierung d(einer) Geschichte die rote Linie?
Was brauchst und erwartest du von deinen Bühnenkolleg*innen, wenn du deine Geschichte performst? Habt ihr Exit- und/oder Care-Strategien gemeinsam entwickelt?
Wie willst du den Bühnenraum gestalten und somit die Nähe bzw. Distanz zum Publikum?
