Phase II - Der Projektaufbau
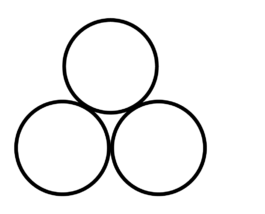
Personenfindung und Zusammenarbeit
Stefan Kaegi, 1972 in Solothurn geboren, studierte Kunst in Zürich und Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen. Mit Helgard Haug und Daniel Wetzel gründete er 2000 das Kollektiv Rimini Protokoll, das für innovative dokumentarische Theaterstücke, Hörspiele und Installationen bekannt ist. Stefan Kaegi und Rimini Protokoll arbeiten regelmässig mit «Expert*innen», die nicht für das, was sie können, sondern für das, was sie sind, ausgewählt werden. Ihre Auftritte speisen sich aus ihrer Biografie und bestimmten Fachkenntnissen. Ihre Arbeiten, wie «Mnemopark» oder «Situation Rooms», wurden weltweit gezeigt. Rimini Protokoll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Silbernen Löwen der Theaterbiennale Venedig. Das Kollektiv wurde mit den Produktionen «Deadline» (2004), «Wallenstein – eine dokumentarische Inszenierung» (2006) und «Situation Rooms» (2014) zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2015 hat Kaegi den Schweizer Grand Prix / Hans-Reinhart-Ring erhalten. Kaegi lebt und arbeitet zwischen Eison (VS) und Berlin.
Bei Rimini Protokoll stehen Menschen, die ihre eigenen Geschichten erzählen, selbst auf der Bühne. Die Begegnung von Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen und Hintergründen ist nicht nur dramaturgisch interessant für das Stück. Das ist auch für die Teilnehmenden selbst ein bereicherndes Erlebnis. Die Kunst bzw. der Proberaum schafft da einen Raum, in dem diese Begegnungen möglich sind, ohne dass sie gleich zu Streit führen müssen, wie sie das vielleicht im Alltag würden. Alle Beteiligten riskieren etwas, verlassen ihre Komfortzone und wissen das auch bei den anderen zu schätzen.
Wir stossen manchmal bei unseren Projekten auf Herausforderungen. Etwa den Schutz eines Aussteigers aus einem mexikanischen Drogenkartell, der bereit war, bei uns mitzuspielen bei „Situation Rooms", einem Projekt über den globalen Waffenhandel, aber natürlich nur unter der Bedingung, dass wir ihn nicht zur Verhaftung freigeben. Es war auch ein deutscher Polizist Teil des Stücks, der versichert hat, dass er kein Interesse daran habe, den Aussteiger zu verhaften. Er war ja auch nicht für Mexiko zuständig. So nahmen beide eher die Gelegenheit wahr, die andere Seite mal wertfrei zu „beschnuppern“.
Im Journalismus ist es oft so, dass man mit Menschen spricht, die moralisch nicht auf derselben Seite stehen.
Es ist entscheidend, den Menschen, mit denen wir arbeiten, von Anfang an transparent zu vermitteln, was sie in einem Theaterstück erwartet. Dabei stellen wir sicher, dass die Protagonist*innen über Probenzeiten und Tourneedaten informiert sind und sich damit wohlfühlen, auf der Bühne zu stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bezahlung, die bei uns selbstverständlich ist. Auch bei szenischen Vorgängen wägen wir genau ab, ob die Beteiligten in der Lage und bereit sind, bestimmte Rollen zu übernehmen, um sicherzustellen, dass ihre Teilnahme für sie moralisch und emotional vertretbar ist.
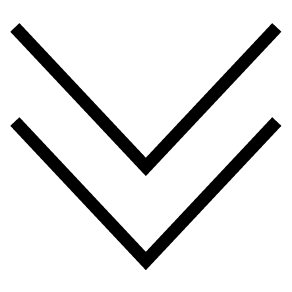
Reflektiere dein Projekt
Könnt und wollt ihr die Protagonist*innen auf der Bühne für ihren Aufwand entschädigen?
Ab wann ist eine Entschädigung sinnvoll – und darf Geld ein Anreiz sein, bei eurem Projekt mitzumachen?
Seid ihr euch darüber im Klaren, bis zu welchem Punkt ihr rechtlichen Schutz garantieren könnt – und ab wann die Beteiligten selbst verantwortlich sind? Sind diese Grenzen auch den Beteiligten klar?
Welchen Konflikten möchtet ihr bei der Auswahl der Personen und in der Gruppenkonstellation vorbeugen – und was bedeutet das für euer Thema?
Phase II - Der Projektaufbau
Personenfindung und Zusammenarbeit
Stefan Kaegi, 1972 in Solothurn geboren, studierte Kunst in Zürich und Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen. Mit Helgard Haug und Daniel Wetzel gründete er 2000 das Kollektiv Rimini Protokoll, das für innovative dokumentarische Theaterstücke, Hörspiele und Installationen bekannt ist. Stefan Kaegi und Rimini Protokoll arbeiten regelmässig mit «Expert*innen», die nicht für das, was sie können, sondern für das, was sie sind, ausgewählt werden. Ihre Auftritte speisen sich aus ihrer Biografie und bestimmten Fachkenntnissen. Ihre Arbeiten, wie «Mnemopark» oder «Situation Rooms», wurden weltweit gezeigt. Rimini Protokoll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Silbernen Löwen der Theaterbiennale Venedig. Das Kollektiv wurde mit den Produktionen «Deadline» (2004), «Wallenstein – eine dokumentarische Inszenierung» (2006) und «Situation Rooms» (2014) zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2015 hat Kaegi den Schweizer Grand Prix / Hans-Reinhart-Ring erhalten. Kaegi lebt und arbeitet zwischen Eison (VS) und Berlin.
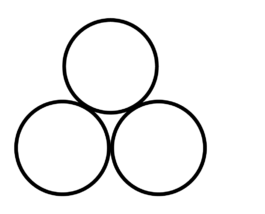
Bei Rimini Protokoll stehen Menschen, die ihre eigenen Geschichten erzählen, selbst auf der Bühne. Die Begegnung von Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen und Hintergründen ist nicht nur dramaturgisch interessant für das Stück. Das ist auch für die Teilnehmenden selbst ein bereicherndes Erlebnis. Die Kunst bzw. der Proberaum schafft da einen Raum, in dem diese Begegnungen möglich sind, ohne dass sie gleich zu Streit führen müssen, wie sie das vielleicht im Alltag würden. Alle Beteiligten riskieren etwas, verlassen ihre Komfortzone und wissen das auch bei den anderen zu schätzen.
Wir stossen manchmal bei unseren Projekten auf Herausforderungen. Etwa den Schutz eines Aussteigers aus einem mexikanischen Drogenkartell, der bereit war, bei uns mitzuspielen bei „Situation Rooms", einem Projekt über den globalen Waffenhandel, aber natürlich nur unter der Bedingung, dass wir ihn nicht zur Verhaftung freigeben. Es war auch ein deutscher Polizist Teil des Stücks, der versichert hat, dass er kein Interesse daran habe, den Aussteiger zu verhaften. Er war ja auch nicht für Mexiko zuständig. So nahmen beide eher die Gelegenheit wahr, die andere Seite mal wertfrei zu „beschnuppern“.
Im Journalismus ist es oft so, dass man mit Menschen spricht, die moralisch nicht auf derselben Seite stehen.
Es ist entscheidend, den Menschen, mit denen wir arbeiten, von Anfang an transparent zu vermitteln, was sie in einem Theaterstück erwartet. Dabei stellen wir sicher, dass die Protagonist*innen über Probenzeiten und Tourneedaten informiert sind und sich damit wohlfühlen, auf der Bühne zu stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bezahlung, die bei uns selbstverständlich ist. Auch bei szenischen Vorgängen wägen wir genau ab, ob die Beteiligten in der Lage und bereit sind, bestimmte Rollen zu übernehmen, um sicherzustellen, dass ihre Teilnahme für sie moralisch und emotional vertretbar ist.
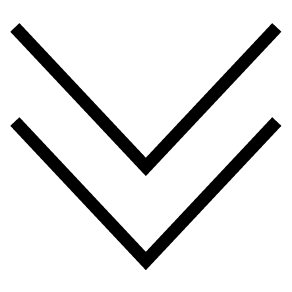
Reflektiere dein Projekt
Könnt und wollt ihr die Protagonist*innen auf der Bühne für ihren Aufwand entschädigen?
Ab wann ist eine Entschädigung sinnvoll – und darf Geld ein Anreiz sein, bei eurem Projekt mitzumachen?
Seid ihr euch darüber im Klaren, bis zu welchem Punkt ihr rechtlichen Schutz garantieren könnt – und ab wann die Beteiligten selbst verantwortlich sind? Sind diese Grenzen auch den Beteiligten klar?
Welchen Konflikten möchtet ihr bei der Auswahl der Personen und in der Gruppenkonstellation vorbeugen – und was bedeutet das für euer Thema?
