Phase IV - Die Transformation
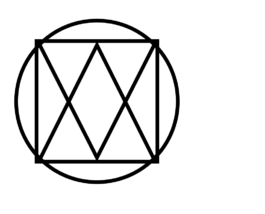
Anonymisierung und Verfremdung im Journalismus
Barbara Achermann ist Schweizer Journalistin und Autorin, aktuell stellvertretende Chefredakteurin bei «Das Magazin». Sie recherchierte und schrieb u.a. über Geschlechterdiskriminierung im Spitalbetrieb oder einen vertuschten Anschlag in Chur, bei dem vier Tamilen ums Leben kamen. 2022 sorgte sie mit zwei Investigativreportagen im Bereich Tanz für Wirbel, Untersuchungen und Entlassungen: «Die Stange der Schande» (2.6.2022 in «Der Zeit», Auszeichnung Swiss Press Award 2023) zeigt Missbrauch und strukturelle Misständen an der Tanzakademie Zürich (TaZ), die zur Hochschule der Künste Zürich gehört, auf. Dem Leitungsteam wurde aufgrund des Artikels fristlos gekündigt. Ein Untersuchungsbericht bestätigte später die Recherche und kam zum Schluss, dass die Fürsorgepflicht «teilweise zu wenig wahrgenommen wurde». Der Artikel «Ich möchte dich heute wirklich anfassen» (28.9.2022 in «Der Zeit») thematisierte sexuelle Belästigung durch einen Probenleiter an der Ballettkompanie am Stadttheater Bern, der kurz daraufhin entlassen wurde.
Ich mache transparent, dass die Wirkung und Glaubwürdigkeit des Artikels umso höher sind, wenn man mit seinem Namen und Foto hinsteht. Das ist auch für mich eine gewisse Absicherung, weil die Leute dann viel weniger dazu tendieren zu übertreiben oder Dinge zu erfinden. Gleichzeitig signalisierte ich Entgegenkommen und Diskussionsbereitschaft. Ich mache deutlich, dass es mir als Journalistin einer seriösen Zeitung nicht ums Ausschlachten von «juicy details» geht, sondern um Systemkritik. Ich biete an, dass sie entweder mit Namen oder mit Bild hinstehen könnten. Erfahrungsgemäss ist auch schon eine Fotografie, welche die Protagonistin z.B. von hinten zeigt, glaubwürdiger als nichts. Und einmal organisierte ich ein Treffen mit einigen Betroffenen, die im Artikel aussagen wollten – da verständlicherweise niemand allein hinstehen wollten, bildeten sich da Allianzen.
Wenn jemand wirklich anonym bleiben möchte, muss man manchmal ein paar Details verfremden. Dann muss man das aber im Artikel deklarieren. Aus mehreren anonymen Protagonisten einen einzigen zusammenstiefeln geht nicht. Eine Möglichkeit ist, transparent zu machen, was nicht gesagt wurde. Also deutlich machen, worüber nicht geredet werden wollte, welche Fragen unbeantwortet blieben etc. Es ist spannend zu erfahren, worüber Leute nicht reden wollen. Das finde ich übrigens auch im dokumentarischen Theater wichtig, dass transparent gemacht wird, was «echt» ist und was nicht.
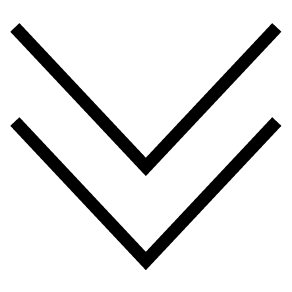
Reflektiere dein Projekt
Anschuldigungsthema: Welche investigativen Grundsätze (zwei unabhängige Quellen, Beweismaterial und Gegenseite Stellung nehmen lassen) scheinen euch wichtig für euer Projekt? Und welche warum nicht?
Umgang mit Anonymität, Verfremdung und Fiktionalisierung in der Kunst: was ist eure ethische Haltung? Wer definiert sie?
Wollt ihr sie im Stück deklarieren und thematisieren?
Wie stellst du sicher, dass du keine «dreckigen» Details ausschlachtest auf Kosten deiner Gesprächspartner*innen?
Phase IV - Die Transformation
Anonymisierung und Verfremdung im Journalismus
Barbara Achermann ist Schweizer Journalistin und Autorin, aktuell stellvertretende Chefredakteurin bei «Das Magazin». Sie recherchierte und schrieb u.a. über Geschlechterdiskriminierung im Spitalbetrieb oder einen vertuschten Anschlag in Chur, bei dem vier Tamilen ums Leben kamen. 2022 sorgte sie mit zwei Investigativreportagen im Bereich Tanz für Wirbel, Untersuchungen und Entlassungen: «Die Stange der Schande» (2.6.2022 in «Der Zeit», Auszeichnung Swiss Press Award 2023) zeigt Missbrauch und strukturelle Misständen an der Tanzakademie Zürich (TaZ), die zur Hochschule der Künste Zürich gehört, auf. Dem Leitungsteam wurde aufgrund des Artikels fristlos gekündigt. Ein Untersuchungsbericht bestätigte später die Recherche und kam zum Schluss, dass die Fürsorgepflicht «teilweise zu wenig wahrgenommen wurde». Der Artikel «Ich möchte dich heute wirklich anfassen» (28.9.2022 in «Der Zeit») thematisierte sexuelle Belästigung durch einen Probenleiter an der Ballettkompanie am Stadttheater Bern, der kurz daraufhin entlassen wurde.
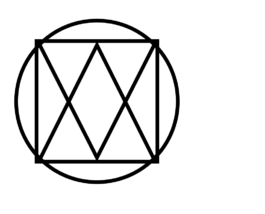
Ich mache transparent, dass die Wirkung und Glaubwürdigkeit des Artikels umso höher sind, wenn man mit seinem Namen und Foto hinsteht. Das ist auch für mich eine gewisse Absicherung, weil die Leute dann viel weniger dazu tendieren zu übertreiben oder Dinge zu erfinden. Gleichzeitig signalisierte ich Entgegenkommen und Diskussionsbereitschaft. Ich mache deutlich, dass es mir als Journalistin einer seriösen Zeitung nicht ums Ausschlachten von «juicy details» geht, sondern um Systemkritik. Ich biete an, dass sie entweder mit Namen oder mit Bild hinstehen könnten. Erfahrungsgemäss ist auch schon eine Fotografie, welche die Protagonistin z.B. von hinten zeigt, glaubwürdiger als nichts. Und einmal organisierte ich ein Treffen mit einigen Betroffenen, die im Artikel aussagen wollten – da verständlicherweise niemand allein hinstehen wollten, bildeten sich da Allianzen.
Wenn jemand wirklich anonym bleiben möchte, muss man manchmal ein paar Details verfremden. Dann muss man das aber im Artikel deklarieren. Aus mehreren anonymen Protagonisten einen einzigen zusammenstiefeln geht nicht. Eine Möglichkeit ist, transparent zu machen, was nicht gesagt wurde. Also deutlich machen, worüber nicht geredet werden wollte, welche Fragen unbeantwortet blieben etc. Es ist spannend zu erfahren, worüber Leute nicht reden wollen. Das finde ich übrigens auch im dokumentarischen Theater wichtig, dass transparent gemacht wird, was «echt» ist und was nicht.
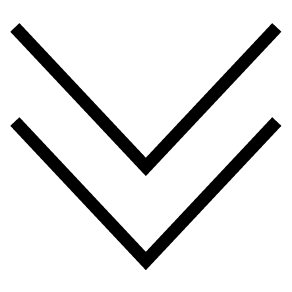
Reflektiere dein Projekt
Anschuldigungsthema: Welche investigativen Grundsätze (zwei unabhängige Quellen, Beweismaterial und Gegenseite Stellung nehmen lassen) scheinen euch wichtig für euer Projekt? Und welche warum nicht?
Umgang mit Anonymität, Verfremdung und Fiktionalisierung in der Kunst: was ist eure ethische Haltung? Wer definiert sie?
Wollt ihr sie im Stück deklarieren und thematisieren?
Wie stellst du sicher, dass du keine «dreckigen» Details ausschlachtest auf Kosten deiner Gesprächspartner*innen?
