Phase 1 - Die Idee
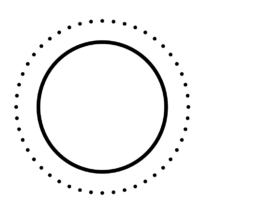
Das Eigene und die Anderen
Corina Schwingruber Ilić (*1981) ist freischaffende Schweizer Filmregisseurin, Editorin und Dozentin, die in Luzern und Belgrad lebt. Ihr Kurzfilm «All Inclusive» (2018) wurde an über 250 Festivals gezeigt, ihr erster Langspielfilm «Dida» (2021) entstand in Co-Regie mit ihrem Ehemann Nikola Ilić. Ihr Film erhielt den Zürcher Filmpreis und war als Bester Dokumentarfilm nominiert für den Schweizer Filmpreis. Er handelt von der Mutter Nikolas und der Schwiegermutter Corinas, Dida, die eine Lernbehinderung hat und nicht eigenständig leben kann.
Beim Konzipieren eines dokumentarischen Projektes ist für mich das Wichtigste, dass es für die Protagonist*innen und ihre Geschichten stimmt. Sie sollen sich wiedererkennen und nicht verraten fühlen. Mein Mann Nikola und ich entschieden uns für unseren ersten gemeinsamen Dokumentarfilm «Dida» für ein autobiografisches Thema: die Pflege seiner lernbehinderten Mutter, die in Serbien lebt und er sich zwischen der Schweiz und Serbien um sie kümmern muss. Wie stellt man jemanden mit einer geistigen Beeinträchtigung dar? – diese Frage dachten wir immer mit. Bei so einem Porträt ist die Regie (und in der Doppelrolle als Verwandte) noch mehr in der Verantwortung. Für uns war es wichtig, wie die Protagonistin des Films am Ende dargestellt wird, wir wollten, dass sie als «Heldin» wahrgenommen wird. Ihre Behinderung wollten wir weder ausnutzen noch ausschlachten, sie wird einfach aufgezeigt als Teil ihres Lebens. Mit dem Resultat, dass die Mutter zwar nicht alle Zusammenhänge der Filmentstehung versteht, aber sehr stolz darauf ist, dass und wie sie im Film gezeigt wird.
Dokumentarisches Filmen im Allgemeinen ist immer eine Gratwanderung und Wirklichkeitsillusion. Mit dem Schnitt, der Szenenwahl, dem Gebrauch der Kamera verfremden wir. Ich versuchte bis anhin immer, so nah wie möglich am Authentischen zu bleiben. Das zwingt einen zwar, vieles wegzulassen, entspricht aber unserem Credo, so wenig wie möglich zu inszenieren.
Ich finde es wichtig, mit so allgemeingültigen, aber persönlichen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Diese Öffentlichkeit muss aber von Anfang an mitgedacht werden: je früher man weiss, wen man mit einem Film ansprechen will, desto einfacher die inhaltliche Entwicklung. Das wurde uns in einem internationalen Entwicklungsworkshop (ExOriente von IDF) bewusst gemacht. Die zentrale Frage hierbei war: Was wollen wir mit dem Film erzählen und wen wollen wir ansprechen? Es geht also nicht nur um unsere inhaltlichen Vorstellungen. In diesem Rahmen entschieden wir uns, unsere Sicht auf die Lebenssituation von Dida, unsere Fragen und unseren Zugang einzubeziehen. Nikolas Bedenken, sich mit seiner ganzen Geschichte auszubreiten und die Distanz zu verlieren, konnten wir so auffangen. Und es hat uns den weiteren Dreh und den Schnitt vereinfacht.
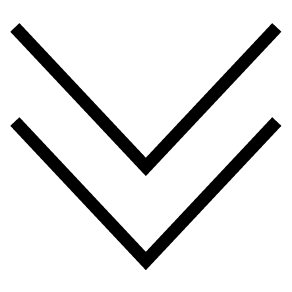
Reflektiere dein Projekt
- Wen soll euer Projekt ansprechen, und was muss dafür inhaltlich thematisiert werden?
- Im Sinne des ethischen Handelns: Seid ihr die richtigen Personen (in den passenden Funktionen) für euer Projekt?
- Ist es sinnvoll / wertvoll / produktiv / nötig, eure eigene Geschichte ins Projekt zu integrieren? Wie verändert das die Thematik eurer Protagonist*innen?
- Wie verhindert ihr, dass die Teilnahme und Darstellung der Beteiligten negative Folgen für sie hat?
- Führt die Beschäftigung mit dem Thema zu einer Re-Traumatisierung der betroffenen Person, oder kann die Auseinandersetzung auch etwas Lösendes (Therapeutisches) haben? Und sind diese therapeutischen Effekte erwünscht?
- Bei Protagonist*innen mit Beeinträchtigung: Wie wollt ihr ihre Teilnahme und ihr Einverständnis sicherstellen und überprüfen? Braucht es spezielle Abmachungen?
Phase I - Die Idee
Das Eigene und die Anderen
Corina Schwingruber Ilić (*1981) ist freischaffende Schweizer Filmregisseurin, Editorin und Dozentin, die in Luzern und Belgrad lebt. Ihr Kurzfilm «All Inclusive» (2018) wurde an über 250 Festivals gezeigt, ihr erster Langspielfilm «Dida» (2021) entstand in Co-Regie mit ihrem Ehemann Nikola Ilić. Ihr Film erhielt den Zürcher Filmpreis und war als Bester Dokumentarfilm nominiert für den Schweizer Filmpreis. Er handelt von der Mutter Nikolas und der Schwiegermutter Corinas, Dida, die eine Lernbehinderung hat und nicht eigenständig leben kann.
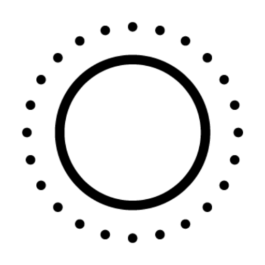
Beim Konzipieren eines dokumentarischen Projektes ist für mich das Wichtigste, dass es für die Protagonist*innen und ihre Geschichten stimmt. Sie sollen sich wiedererkennen und nicht verraten fühlen. Mein Mann Nikola und ich entschieden uns für unseren ersten gemeinsamen Dokumentarfilm «Dida» für ein autobiografisches Thema: die Pflege seiner lernbehinderten Mutter, die in Serbien lebt und er sich zwischen der Schweiz und Serbien um sie kümmern muss. Wie stellt man jemanden mit einer geistigen Beeinträchtigung dar? – diese Frage dachten wir immer mit. Bei so einem Porträt ist die Regie (und in der Doppelrolle als Verwandte) noch mehr in der Verantwortung. Für uns war es wichtig, wie die Protagonistin des Films am Ende dargestellt wird, wir wollten, dass sie als «Heldin» wahrgenommen wird. Ihre Behinderung wollten wir weder ausnutzen noch ausschlachten, sie wird einfach aufgezeigt als Teil ihres Lebens. Mit dem Resultat, dass die Mutter zwar nicht alle Zusammenhänge der Filmentstehung versteht, aber sehr stolz darauf ist, dass und wie sie im Film gezeigt wird.
Dokumentarisches Filmen im Allgemeinen ist immer eine Gratwanderung und Wirklichkeitsillusion. Mit dem Schnitt, der Szenenwahl, dem Gebrauch der Kamera verfremden wir. Ich versuchte bis anhin immer, so nah wie möglich am Authentischen zu bleiben. Das zwingt einen zwar, vieles wegzulassen, entspricht aber unserem Credo, so wenig wie möglich zu inszenieren.
Ich finde es wichtig, mit so allgemeingültigen, aber persönlichen Themen an die Öffentlichkeit zu gehen. Diese Öffentlichkeit muss aber von Anfang an mitgedacht werden: je früher man weiss, wen man mit einem Film ansprechen will, desto einfacher die inhaltliche Entwicklung. Das wurde uns in einem internationalen Entwicklungsworkshop (ExOriente von IDF) bewusst gemacht. Die zentrale Frage hierbei war: Was wollen wir mit dem Film erzählen und wen wollen wir ansprechen? Es geht also nicht nur um unsere inhaltlichen Vorstellungen. In diesem Rahmen entschieden wir uns, unsere Sicht auf die Lebenssituation von Dida, unsere Fragen und unseren Zugang einzubeziehen. Nikolas Bedenken, sich mit seiner ganzen Geschichte auszubreiten und die Distanz zu verlieren, konnten wir so auffangen. Und es hat uns den weiteren Dreh und den Schnitt vereinfacht.
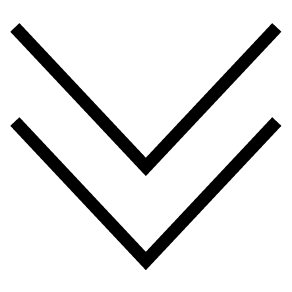
Reflektiere dein Projekt
- Wen soll euer Projekt ansprechen, und was muss dafür inhaltlich thematisiert werden?
- Im Sinne des ethischen Handelns: Seid ihr die richtigen Personen (in den passenden Funktionen) für euer Projekt?
- Ist es sinnvoll / wertvoll / produktiv / nötig, eure eigene Geschichte ins Projekt zu integrieren? Wie verändert das die Thematik eurer Protagonist*innen?
- Wie verhindert ihr, dass die Teilnahme und Darstellung der Beteiligten negative Folgen für sie hat?
- Führt die Beschäftigung mit dem Thema zu einer Re-Traumatisierung der betroffenen Person, oder kann die Auseinandersetzung auch etwas Lösendes (Therapeutisches) haben? Und sind diese therapeutischen Effekte erwünscht?
- Bei Protagonist*innen mit Beeinträchtigung: Wie wollt ihr ihre Teilnahme und ihr Einverständnis sicherstellen und überprüfen? Braucht es spezielle Abmachungen?
