Phase III - Das Gespräch
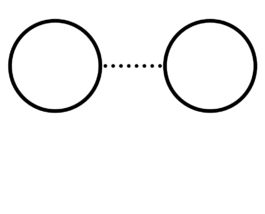
Ein einfühlsames Gespräch (mit traumatisierten Menschen)
Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.
Ein achtsamer Umgang mit der Gesprächssituation ist essenziell, um traumatisierte Menschen nicht zu überfordern. Dabei spielt die Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, eine grosse Rolle. Es ist hilfreich, immer wieder nachzufragen, ob sich die Person mit dem Gesprächsverlauf wohlfühlt. Indem man Wahlmöglichkeiten anbietet – etwa: «Möchtest du es lieber so oder so?» – gibt man den Betroffenen Kontrolle zurück.
Auch Pausen sind ein wichtiger Bestandteil eines einfühlsamen Gesprächs. Viele Menschen spüren, wenn ein Thema sie emotional belastet, trauen sich aber nicht, eine Pause einzufordern. Deshalb sollte aktiv angeboten werden, das Gespräch zu unterbrechen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Betroffene auch die Freiheit haben, Fragen unbeantwortet zu lassen. Dies ist für viele nicht selbstverständlich, da sie es aus behördlichen Anhörungen gewohnt sind, alles sagen zu müssen – oft unter dem Druck, dass Auslassungen negative Konsequenzen haben könnten. Hier muss klar kommuniziert werden, dass ein Interview nicht den gleichen Zwängen unterliegt und dass es völlig legitim ist, eine Frage nicht zu beantworten.
Neben der inhaltlichen Struktur des Gesprächs ist auch die Haltung der Gesprächsführenden entscheidend. Eine empathische, aufmerksame und flexible Gesprächsführung ist essenziell. Das bedeutet, das Tempo dem Gegenüber anzupassen, Anzeichen von Überforderung zu erkennen und gegebenenfalls das Thema zu wechseln oder das Gespräch zu beenden. Für Menschen mit Erfahrung im Theater sind viele nonverbale Signale bereits vertraut, dennoch gibt es spezifische Zeichen, die auf eine starke Belastung oder eine drohende Dissoziation hinweisen können.
DISCLAIMER:
Hier findet ihr eine Liste von Àdam Bodò mit Beispielen für Warnzeichen bei traumatisierten Menschen. Diese Liste dient nicht zur eigenständigen Einschätzung oder Behandlung.
Je komplexer die Voraussetzungen zu eurem Projekt sind, desto ratsamer ist es, eine professionelle Unterstützung hinzuzuziehen – beispielsweise durch eine*n Traumatherapeut*in.
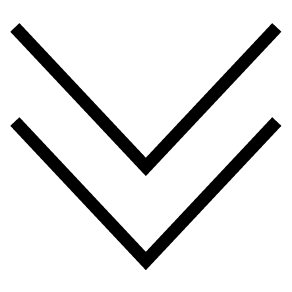
Reflektiere dein Projekt
Konntest du in deinem Projektaufbau und in der Vorbereitung genügend Kenntnisse aufbauen, um ein einfühlsames Gegenüber zu sein, das die Gesprächsperson nicht überfordert?
Was ist dein Konzept für Gesprächspausen? Wann setzt du diese ein?
Ist eine Person bei dem Projekt beteiligt, die diese professionell deuten kann, um gegebenenfalls zu unterbrechen, Pausen einzulegen oder das Gespräch abzubrechen?
Wie fängst du mögliche interkulturelle Differenzen im Gespräch auf?
Phase III - Das Gespräch
Ein einfühlsames Gespräch (mit traumatisierten Menschen)
Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.
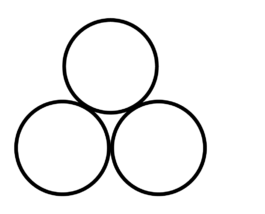
Ein achtsamer Umgang mit der Gesprächssituation ist essenziell, um traumatisierte Menschen nicht zu überfordern. Dabei spielt die Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, eine grosse Rolle. Es ist hilfreich, immer wieder nachzufragen, ob sich die Person mit dem Gesprächsverlauf wohlfühlt. Indem man Wahlmöglichkeiten anbietet – etwa: «Möchtest du es lieber so oder so?» – gibt man den Betroffenen Kontrolle zurück.
Auch Pausen sind ein wichtiger Bestandteil eines einfühlsamen Gesprächs. Viele Menschen spüren, wenn ein Thema sie emotional belastet, trauen sich aber nicht, eine Pause einzufordern. Deshalb sollte aktiv angeboten werden, das Gespräch zu unterbrechen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Betroffene auch die Freiheit haben, Fragen unbeantwortet zu lassen. Dies ist für viele nicht selbstverständlich, da sie es aus behördlichen Anhörungen gewohnt sind, alles sagen zu müssen – oft unter dem Druck, dass Auslassungen negative Konsequenzen haben könnten. Hier muss klar kommuniziert werden, dass ein Interview nicht den gleichen Zwängen unterliegt und dass es völlig legitim ist, eine Frage nicht zu beantworten.
Neben der inhaltlichen Struktur des Gesprächs ist auch die Haltung der Gesprächsführenden entscheidend. Eine empathische, aufmerksame und flexible Gesprächsführung ist essenziell. Das bedeutet, das Tempo dem Gegenüber anzupassen, Anzeichen von Überforderung zu erkennen und gegebenenfalls das Thema zu wechseln oder das Gespräch zu beenden. Für Menschen mit Erfahrung im Theater sind viele nonverbale Signale bereits vertraut, dennoch gibt es spezifische Zeichen, die auf eine starke Belastung oder eine drohende Dissoziation hinweisen können.
DISCLAIMER:
Hier findet ihr eine Liste von Àdam Bodò mit Beispielen für Warnzeichen bei traumatisierten Menschen. Diese Liste dient nicht zur eigenständigen Einschätzung oder Behandlung.
Je komplexer die Voraussetzungen zu eurem Projekt sind, desto ratsamer ist es, eine professionelle Unterstützung hinzuzuziehen – beispielsweise durch eine*n Traumatherapeut*in.
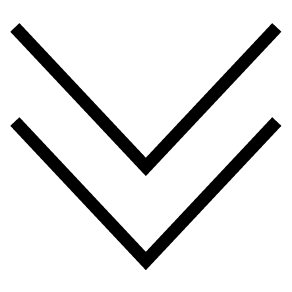
Reflektiere dein Projekt
Konntest du in deinem Projektaufbau und in der Vorbereitung genügend Kenntnisse aufbauen, um ein einfühlsames Gegenüber zu sein, das die Gesprächsperson nicht überfordert?
Was ist dein Konzept für Gesprächspausen? Wann setzt du diese ein?
Ist eine Person bei dem Projekt beteiligt, die diese professionell deuten kann, um gegebenenfalls zu unterbrechen, Pausen einzulegen oder das Gespräch abzubrechen?
Wie fängst du mögliche interkulturelle Differenzen im Gespräch auf?
