Phase III - Das Gespräch
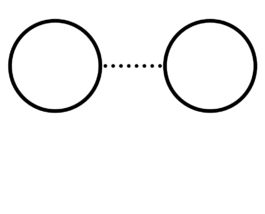
Nach einem Gespräch mit traumatisierten Personen
Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.
Nach einem Gespräch, in dem möglicherweise traumatische Themen angesprochen wurden, ist es wichtig, auf das Wohlbefinden der betroffenen Person zu achten. Zunächst sollte unmittelbar nach dem Gespräch nachgefragt werden, wie es der Person geht. Es ist ratsam, ein bis zwei Wochen später noch einmal nachzufragen, ob das Gespräch etwas ausgelöst hat und ob alles in Ordnung ist. Wenn die betroffene Person in Therapie ist, sollte vorab geklärt werden, dass der/die Therapeut*in informiert wird, damit etwaige Reaktionen auf das Gespräch in der Therapie besprochen werden können.
Sollte das Gespräch bei der betroffenen Person negative Auswirkungen haben und sie sich in einem schlechten Zustand befinden, ist es wichtig, sofort nach Unterstützung zu suchen und gegebenenfalls professionelle Hilfe anzubieten. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, gemeinsam mit der Person zu einem/r Therapeut*in zu gehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sekundärtraumatisierung, die auch bei Übersetzer*innen oder Helfer*innen auftreten kann. Wenn diese Personen ebenfalls geflüchtet sind, können ähnliche traumatische Reaktionen ausgelöst werden. Es gilt auch bei den Übersetzern nachzufragen, wie es ihnen geht und gegebenenfalls sollte dasselbe Angebot gemacht werden.
Sekundärtraumatisierung ist ein Phänomen, bei dem Menschen, die nicht direkt in die traumatischen Ereignisse involviert waren, dennoch Symptome entwickeln, nachdem sie von den Erlebnissen traumatisierter Personen erfahren haben. Ein weitverbreitetes Phänomen, insbesondere bei Helfer*innen in sozialen Berufen, Therapeut*innen, Lehrkräften und auch Theaterschaffenden, die mit solchen Geschichten konfrontiert werden. Wenn sie feststellen, dass die Bilder und Themen aus den Gesprächen sie auch nach Wochen oder Monaten weiterhin beschäftigen oder in ihren Träumen auftauchen, kann dies ein Zeichen für eine Sekundärtraumatisierung sein.
Es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein «normales» Phänomen ist und nichts mit der Qualität des Gesprächs zu tun hat. In solchen Fällen sollte ebenfalls professionelle Unterstützung gesucht werden, um mit den Auswirkungen dieser Sekundärtraumatisierung umzugehen.
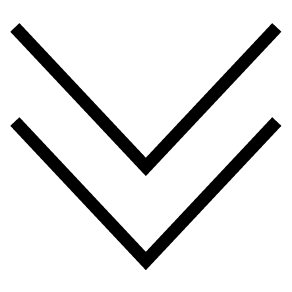
Reflektiere dein Projekt
Wie gehst du ein direktes Nachgespräch an? Habt ihr einen Check-In nach ein bis zwei Wochen vereinbart?
Ist eine mögliche Therapeut*in über den Verlauf des Gesprächs informiert?
Habt ihr Check-Ins und Nachgespräche auch mit Übersetzer*innen oder Brückenpersonen, die am Gespräch teilnehmen?
Wie und mit wem kannst du dich über das Gesprochene austauschen – ohne Persönlichkeitsrechte und gemeinsame Abmachungen zu verletzen?
Phase III - Das Gespräch
Nach einem Gespräch mit traumatisierten Personen
Àdam Bodò ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie FMH sowie systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapeut. Seine Spezialgebiete umfassen Therapien im Migrationsbereich, Traumatherapie und Hypnotherapie. Geboren in Ungarn, wuchs er in Budapest auf, wo er Medizin studierte. Mit 25 Jahren zog er in die Schweiz. Seine enge Verbindung zum Theater entwickelte sich bereits in seiner Heimatstadt, einer lebendigen Theatermetropole, die seine künstlerische und kulturelle Wahrnehmung nachhaltig prägte. Bodò begleitet traumatisierte Menschen in der Therapie durch drei Phasen. Zunächst geht es darum, innere Stabilität zu erlangen. Danach folgt die kontrollierte Auseinandersetzung mit dem Trauma, bei der Betroffene lernen, ihre Emotionen zu regulieren. Ein zentraler Schritt ist der Perspektivwechsel: Sie sollen sich nicht mehr als hilflose Opfer, sondern als eigenmächtig Handelnde wahrnehmen. Schliesslich geht es darum, das Erlebte zu integrieren und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.
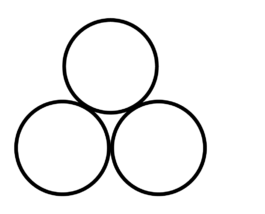
Nach einem Gespräch, in dem möglicherweise traumatische Themen angesprochen wurden, ist es wichtig, auf das Wohlbefinden der betroffenen Person zu achten. Zunächst sollte unmittelbar nach dem Gespräch nachgefragt werden, wie es der Person geht. Es ist ratsam, ein bis zwei Wochen später noch einmal nachzufragen, ob das Gespräch etwas ausgelöst hat und ob alles in Ordnung ist. Wenn die betroffene Person in Therapie ist, sollte vorab geklärt werden, dass der/die Therapeut*in informiert wird, damit etwaige Reaktionen auf das Gespräch in der Therapie besprochen werden können.
Sollte das Gespräch bei der betroffenen Person negative Auswirkungen haben und sie sich in einem schlechten Zustand befinden, ist es wichtig, sofort nach Unterstützung zu suchen und gegebenenfalls professionelle Hilfe anzubieten. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, gemeinsam mit der Person zu einem/r Therapeut*in zu gehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sekundärtraumatisierung, die auch bei Übersetzer*innen oder Helfer*innen auftreten kann. Wenn diese Personen ebenfalls geflüchtet sind, können ähnliche traumatische Reaktionen ausgelöst werden. Es gilt auch bei den Übersetzern nachzufragen, wie es ihnen geht und gegebenenfalls sollte dasselbe Angebot gemacht werden.
Sekundärtraumatisierung ist ein Phänomen, bei dem Menschen, die nicht direkt in die traumatischen Ereignisse involviert waren, dennoch Symptome entwickeln, nachdem sie von den Erlebnissen traumatisierter Personen erfahren haben. Ein weitverbreitetes Phänomen, insbesondere bei Helfer*innen in sozialen Berufen, Therapeut*innen, Lehrkräften und auch Theaterschaffenden, die mit solchen Geschichten konfrontiert werden. Wenn sie feststellen, dass die Bilder und Themen aus den Gesprächen sie auch nach Wochen oder Monaten weiterhin beschäftigen oder in ihren Träumen auftauchen, kann dies ein Zeichen für eine Sekundärtraumatisierung sein.
Es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein «normales» Phänomen ist und nichts mit der Qualität des Gesprächs zu tun hat. In solchen Fällen sollte ebenfalls professionelle Unterstützung gesucht werden, um mit den Auswirkungen dieser Sekundärtraumatisierung umzugehen.
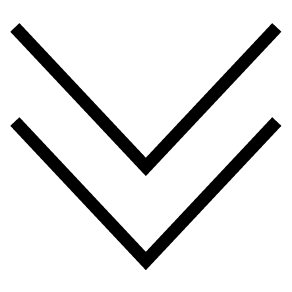
Reflektiere dein Projekt
Wie gehst du ein direktes Nachgespräch an? Habt ihr einen Check-In nach ein bis zwei Wochen vereinbart?
Ist eine mögliche Therapeut*in über den Verlauf des Gesprächs informiert?
Habt ihr Check-Ins und Nachgespräche auch mit Übersetzer*innen oder Brückenpersonen, die am Gespräch teilnehmen?
Wie und mit wem kannst du dich über das Gesprochene austauschen – ohne Persönlichkeitsrechte und gemeinsame Abmachungen zu verletzen?
