Phase IV - Die Transformation
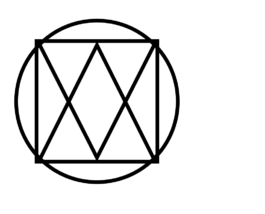
Produktives Pingpong und Anonymisierung
Stefan Kaegi, 1972 in Solothurn geboren, studierte Kunst in Zürich und Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen. Mit Helgard Haug und Daniel Wetzel gründete er 2000 das Kollektiv Rimini Protokoll, das für innovative dokumentarische Theaterstücke, Hörspiele und Installationen bekannt ist. Stefan Kaegi und Rimini Protokoll arbeiten regelmässig mit «Expert*innen», die nicht für das, was sie können, sondern für das, was sie sind, ausgewählt werden. Ihre Auftritte speisen sich aus ihrer Biografie und bestimmten Fachkenntnissen. Ihre Arbeiten, wie «Mnemopark» oder «Situation Rooms», wurden weltweit gezeigt. Rimini Protokoll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Silbernen Löwen der Theaterbiennale Venedig. Das Kollektiv wurde mit den Produktionen «Deadline» (2004), «Wallenstein – eine dokumentarische Inszenierung» (2006) und «Situation Rooms» (2014) zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2015 hat Kaegi den Schweizer Grand Prix / Hans-Reinhart-Ring erhalten. Kaegi lebt und arbeitet zwischen Eison (VS) und Berlin.
Wir wollten das Prinzip des «One Take» überwinden, bei dem man ein Interview führt, transkribiert und dann das Material sortiert. Stattdessen faszinierte uns die Idee, das Material gemeinsam mit den Beteiligten weiterzuentwickeln. Nach dem ersten Interview geben wir den Text an die Person zurück und fragen, ob sie sich vorstellen könnte, das auf der Bühne zu sagen. Oft bitten wir, bestimmte Aspekte zu betonen und andere wegzulassen, je nach Kontext des Stücks. Es entsteht ein Dialog, bei dem die Beteiligten mitbestimmten, was sie auf der Bühne nicht sagen möchten, aus Angst vor Exposition und den Konsequenzen. Dies führt zu einer produktiven Reibung, einem monatelangen «Pingpong», bei dem die Geschichten immer feiner angepasst werden.
Beispiele für Anonymisierung gibt’s unterschiedliche: getönte Scheiben, verfremdete Stimme, Anonymisierung oder Auslassung von Namen und Geschäft. Im Dokumentartheater können so Leerstellen der Geschichten sichtbar gemacht werden.
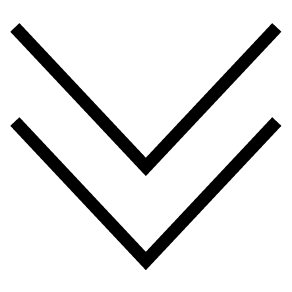
Reflektiere dein Projekt
Seid ihr euch und den Beteiligten gegenüber im Klaren, welche Art der Mitsprache, der Materialentwicklung und des Austauschs ihr anstrebt – und wie die Person mitbestimmen darf?
Wie „verhandelt“ ihr das Mitspracherecht der Projektbeteiligten, die ihre Geschichte teilen?
Wenn die Beteiligten der Verwendung von bestimmtem Material nicht zustimmen, wie verhaltet ihr euch? Anonymisiert ihr Dinge, macht ihr das „Nicht-sagen-Dürfen/-Können“ offen, kennzeichnet ihr Schweigen oder Leerstellen?
Welche Formen der Anonymisierung sind für euer Projekt denkbar und passend? Und wer definiert das?
Habt ihr genug Zeit fürs Pingpong eingeplant – und wissen die Beteiligten, was für Schreibarbeit auf sie zukommen kann?
Phase IV - Die Transformation
Produktives Pingpong und Anonymisierung
Stefan Kaegi, 1972 in Solothurn geboren, studierte Kunst in Zürich und Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen. Mit Helgard Haug und Daniel Wetzel gründete er 2000 das Kollektiv Rimini Protokoll, das für innovative dokumentarische Theaterstücke, Hörspiele und Installationen bekannt ist. Stefan Kaegi und Rimini Protokoll arbeiten regelmässig mit «Expert*innen», die nicht für das, was sie können, sondern für das, was sie sind, ausgewählt werden. Ihre Auftritte speisen sich aus ihrer Biografie und bestimmten Fachkenntnissen. Ihre Arbeiten, wie «Mnemopark» oder «Situation Rooms», wurden weltweit gezeigt. Rimini Protokoll erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Silbernen Löwen der Theaterbiennale Venedig. Das Kollektiv wurde mit den Produktionen «Deadline» (2004), «Wallenstein – eine dokumentarische Inszenierung» (2006) und «Situation Rooms» (2014) zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2015 hat Kaegi den Schweizer Grand Prix / Hans-Reinhart-Ring erhalten. Kaegi lebt und arbeitet zwischen Eison (VS) und Berlin.
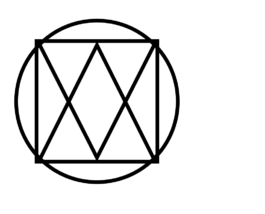
Wir wollten das Prinzip des «One Take» überwinden, bei dem man ein Interview führt, transkribiert und dann das Material sortiert. Stattdessen faszinierte uns die Idee, das Material gemeinsam mit den Beteiligten weiterzuentwickeln. Nach dem ersten Interview geben wir den Text an die Person zurück und fragen, ob sie sich vorstellen könnte, das auf der Bühne zu sagen. Oft bitten wir, bestimmte Aspekte zu betonen und andere wegzulassen, je nach Kontext des Stücks. Es entsteht ein Dialog, bei dem die Beteiligten mitbestimmten, was sie auf der Bühne nicht sagen möchten, aus Angst vor Exposition und den Konsequenzen. Dies führt zu einer produktiven Reibung, einem monatelangen «Pingpong», bei dem die Geschichten immer feiner angepasst werden.
Beispiele für Anonymisierung gibt’s unterschiedliche: getönte Scheiben, verfremdete Stimme, Anonymisierung oder Auslassung von Namen und Geschäft. Im Dokumentartheater können so Leerstellen der Geschichten sichtbar gemacht werden.
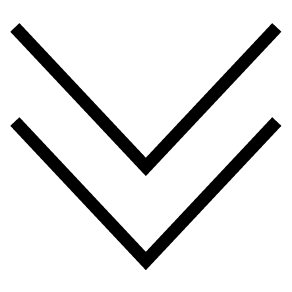
Reflektiere dein Projekt
Seid ihr euch und den Beteiligten gegenüber im Klaren, welche Art der Mitsprache, der Materialentwicklung und des Austauschs ihr anstrebt – und wie die Person mitbestimmen darf?
Wie „verhandelt“ ihr das Mitspracherecht der Projektbeteiligten, die ihre Geschichte teilen?
Wenn die Beteiligten der Verwendung von bestimmtem Material nicht zustimmen, wie verhaltet ihr euch? Anonymisiert ihr Dinge, macht ihr das „Nicht-sagen-Dürfen/-Können“ offen, kennzeichnet ihr Schweigen oder Leerstellen?
Welche Formen der Anonymisierung sind für euer Projekt denkbar und passend? Und wer definiert das?
Habt ihr genug Zeit fürs Pingpong eingeplant – und wissen die Beteiligten, was für Schreibarbeit auf sie zukommen kann?
